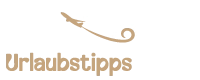Die sanfte Mobilität revolutioniert die Art und Weise, wie wir uns in Städten fortbewegen. Sie steht für ein Verkehrskonzept, das den Menschen und die Umwelt in den Mittelpunkt stellt. Angesichts wachsender Urbanisierung und steigender Umweltbelastungen gewinnt dieser Ansatz zunehmend an Bedeutung. Von innovativen Shared-Space-Konzepten bis hin zu intelligenten Verkehrssteuerungssystemen – sanfte Mobilität umfasst eine Vielzahl von Massnahmen, die darauf abzielen, den Stadtverkehr effizienter, umweltfreundlicher und lebenswerter zu gestalten. Wie können Städte diese Konzepte erfolgreich umsetzen und welche Vorteile ergeben sich daraus für Bewohner und Umwelt?
Grundlagen der sanften Mobilität: Verkehrsberuhigung und Shared Space
Das Konzept der sanften Mobilität basiert auf der Idee, den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren und alternative Fortbewegungsarten zu fördern. Ein zentrales Element hierbei ist die Verkehrsberuhigung. Durch Massnahmen wie Tempo-30-Zonen, Einbahnstrassenregelungen oder die Schaffung von Fussgängerzonen wird der Verkehrsfluss verlangsamt und die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer erhöht.
Ein innovativer Ansatz in diesem Bereich ist das Shared-Space-Konzept. Hierbei werden Verkehrszeichen, Ampeln und Fahrbahnmarkierungen weitgehend entfernt, um einen gemeinsamen Raum für alle Verkehrsteilnehmer zu schaffen. Die Idee dahinter: Durch die fehlende Regulierung werden Autofahrer, Radfahrer und Fussgänger gezwungen, mehr aufeinander zu achten und rücksichtsvoller miteinander umzugehen.
Studien zeigen, dass Shared-Space-Zonen zu einer Reduktion von Unfällen um bis zu 50% führen können. Gleichzeitig steigt die Aufenthaltsqualität in diesen Bereichen deutlich an, was sich positiv auf lokale Geschäfte und die soziale Interaktion auswirkt.
Shared Space ermöglicht ein harmonisches Miteinander aller Verkehrsteilnehmer und schafft lebenswertere öffentliche Räume in unseren Städten.
Trotz der Vorteile ist die Umsetzung von Shared-Space-Konzepten nicht ohne Herausforderungen. Es bedarf einer sorgfältigen Planung und Kommunikation mit allen Beteiligten, um Akzeptanz zu schaffen und potenzielle Sicherheitsbedenken auszuräumen.
Multimodale Verkehrskonzepte: Integration von ÖPNV, Radverkehr und Fussgängern
Ein Schlüsselelement der sanften Mobilität ist die nahtlose Integration verschiedener Verkehrsmittel. Multimodale Verkehrskonzepte zielen darauf ab, den Umstieg zwischen öffentlichem Nahverkehr, Fahrrad und Fusswegen so einfach und attraktiv wie möglich zu gestalten. Dadurch soll die Abhängigkeit vom privaten PKW reduziert und eine flexiblere, umweltfreundlichere Fortbewegung ermöglicht werden.
Zentral für den Erfolg multimodaler Konzepte ist eine gut ausgebaute Infrastruktur, die die verschiedenen Verkehrsmittel miteinander verknüpft. Hierzu gehören beispielsweise sichere und komfortable Fahrradwege, die direkt zu ÖPNV-Haltestellen führen, sowie ausreichend Fahrradabstellplätze an Bahnhöfen und wichtigen Verkehrsknotenpunkten.
Aktuelle Zahlen belegen den Erfolg solcher Massnahmen: In Städten mit gut ausgebauter multimodaler Infrastruktur steigt der Anteil des Radverkehrs und der ÖPNV-Nutzung deutlich an. So konnte beispielsweise Kopenhagen durch konsequente Förderung des Radverkehrs den Anteil der mit dem Fahrrad zurückgelegten Wege auf über 60% steigern.
Mobilitätsstationen: Verknüpfung verschiedener Verkehrsmittel am Beispiel Münchens
Ein Paradebeispiel für die erfolgreiche Umsetzung multimodaler Verkehrskonzepte sind die Mobilitätsstationen in München. An strategisch wichtigen Punkten im Stadtgebiet wurden Knotenpunkte geschaffen, die verschiedene Verkehrsmittel intelligent miteinander verknüpfen.
Eine typische Münchner Mobilitätsstation bietet:
- Sichere Abstellmöglichkeiten für private Fahrräder
- Leihfahrräder und E-Bikes
- Carsharing-Angebote
- Ladestationen für Elektrofahrzeuge
- Direkte Anbindung an den ÖPNV
Durch dieses umfassende Angebot wird es für Pendler und Stadtbewohner attraktiver, auf den eigenen PKW zu verzichten und stattdessen flexible Kombinationen verschiedener Verkehrsmittel zu nutzen. Erste Auswertungen zeigen, dass die Mobilitätsstationen gut angenommen werden und zu einer Reduktion des motorisierten Individualverkehrs in den umliegenden Gebieten beitragen.
Bike-and-Ride-Systeme: Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen in den Niederlanden
Die Niederlande gelten seit langem als Vorreiter in Sachen Fahrradinfrastruktur. Ein besonders erfolgreiches Konzept sind die grossen Fahrradparkhäuser an wichtigen Bahnhöfen. Diese ermöglichen es Pendlern, sicher und bequem mit dem Fahrrad zum Bahnhof zu fahren und dort auf den Zug umzusteigen.
Das grösste Fahrradparkhaus der Welt befindet sich in Utrecht und bietet Platz für über 12.500 Fahrräder. Es ist direkt mit dem Hauptbahnhof verbunden und ermöglicht einen schnellen und reibungslosen Umstieg zwischen Fahrrad und Zug. Neben sicheren Abstellplätzen bietet das Parkhaus auch Serviceleistungen wie Fahrradreparatur und -verleih an.
Der Erfolg dieses Konzepts spiegelt sich in den Nutzerzahlen wider: Über 40% der Zugreisenden in den Niederlanden nutzen das Fahrrad als Zubringer zum Bahnhof. Dies entlastet nicht nur die Strassen in Bahnhofsnähe, sondern fördert auch die aktive Mobilität und trägt zur Reduktion von CO2-Emissionen bei.
Mikromobilität: E-Scooter und Leihfahrräder in Berlin
In den letzten Jahren hat sich die Mikromobilität als wichtiger Baustein sanfter Mobilitätskonzepte etabliert. Besonders in Grossstädten wie Berlin erfreuen sich E-Scooter und Leihfahrräder wachsender Beliebtheit. Sie bieten eine flexible Möglichkeit, kurze bis mittlere Strecken schnell und umweltfreundlich zurückzulegen.
Berlin verfügt über ein dichtes Netz von Leihstationen für Fahrräder und E-Scooter. Allein das städtische Fahrradverleihsystem „Nextbike“ bietet über 5.500 Leihräder an mehr als 700 Stationen. Hinzu kommen zahlreiche private Anbieter für E-Scooter und stationslose Leihfahrräder.
Die Integration dieser Mikromobilitätsangebote in den bestehenden ÖPNV spielt eine entscheidende Rolle. So können Nutzer beispielsweise mit einer einzigen App sowohl ÖPNV-Tickets buchen als auch Leihfahrräder oder E-Scooter freischalten. Dies erleichtert die kombinierte Nutzung verschiedener Verkehrsmittel und macht den Verzicht auf das eigene Auto attraktiver.
Mikromobilität schliesst die Lücke zwischen ÖPNV und Fusswegen und ermöglicht eine flexible, umweltfreundliche Fortbewegung in der Stadt.
Trotz der Vorteile stehen Städte bei der Integration von Mikromobilität vor Herausforderungen. Dazu gehören die Schaffung sicherer Abstellmöglichkeiten, die Regulierung der Nutzung im öffentlichen Raum und die Gewährleistung der Verkehrssicherheit für alle Teilnehmer.
Elektromobilität als Schlüssel zur Emissionsreduktion im Stadtverkehr
Die Elektromobilität spielt eine zentrale Rolle bei der Reduzierung von Emissionen im Stadtverkehr. Durch den Umstieg auf elektrisch betriebene Fahrzeuge können Luftverschmutzung und Lärmbelastung in urbanen Räumen signifikant reduziert werden. Städte weltweit setzen daher verstärkt auf die Förderung von E-Autos, E-Bussen und elektrischen Nutzfahrzeugen.
Ein entscheidender Faktor für den Erfolg der Elektromobilität ist der Ausbau der Ladeinfrastruktur. Hier haben viele Städte in den letzten Jahren grosse Fortschritte gemacht. So verfügt Deutschland mittlerweile über mehr als 60.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte, Tendenz stark steigend.
Neben der Reduktion von CO2-Emissionen bietet die Elektromobilität weitere Vorteile für den Stadtverkehr:
- Geringere Lärmbelastung durch leise Elektromotoren
- Verbesserung der Luftqualität durch Wegfall lokaler Emissionen
- Potenzial für innovative Mobilitätskonzepte wie E-Carsharing
- Möglichkeit der Energiespeicherung in Fahrzeugbatterien zur Netzstabilisierung
Ladeinfrastruktur: Schnellladesäulen und induktives Laden in Oslo
Oslo gilt als Vorreiter in Sachen Elektromobilität und verfügt über eine der am besten ausgebauten Ladeinfrastrukturen Europas. Die norwegische Hauptstadt setzt dabei auf einen Mix aus verschiedenen Ladetechnologien, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der E-Auto-Nutzer gerecht zu werden.
Ein Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau von Schnellladesäulen, die eine Aufladung in weniger als 30 Minuten ermöglichen. Diese finden sich vor allem an stark frequentierten Orten wie Einkaufszentren oder Parkplätzen. Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche Normalladepunkte in Wohngebieten und an Arbeitsplätzen.
Besonders innovativ ist der Einsatz von induktiven Ladesystemen im öffentlichen Raum. An ausgewählten Taxiständen können E-Taxis kabellos aufladen, während sie auf Fahrgäste warten. Dies erhöht die Effizienz und Attraktivität elektrischer Taxis im Stadtverkehr.
Der Erfolg dieser Strategie spiegelt sich in den Zulassungszahlen wider: In Oslo sind bereits über 60% der Neuzulassungen Elektrofahrzeuge. Dies trägt massgeblich zur Verbesserung der Luftqualität und Reduktion von Verkehrsemissionen in der Stadt bei.
E-Busse im ÖPNV: Erfahrungen aus dem Pilotprojekt in Hamburg
Hamburg hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 den gesamten öffentlichen Nahverkehr auf emissionsfreie Antriebe umzustellen. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist der Einsatz von Elektrobussen. Seit 2014 läuft in der Hansestadt ein umfangreiches Pilotprojekt, das wertvolle Erkenntnisse für die flächendeckende Einführung von E-Bussen liefert.
Die Hamburger Hochbahn setzt dabei auf verschiedene Technologien:
- Batterieelektrische Busse für kürzere Strecken
- Brennstoffzellenbusse für längere Routen
- Opportunity Charging an Endhaltestellen für schnelles Zwischenladen
Die bisherigen Erfahrungen sind überwiegend positiv. Die E-Busse zeichnen sich durch geringere Betriebskosten, niedrigere Lärmemissionen und eine hohe Zuverlässigkeit aus. Herausforderungen bestehen noch bei der Reichweite und der Anpassung der Betriebsabläufe an die spezifischen Anforderungen der Elektrobusse.
Ein interessanter Nebeneffekt: Die Einführung von E-Bussen hat zu einer Imageaufwertung des ÖPNV geführt. Fahrgäste schätzen die ruhige, emissionsfreie Fahrt und nehmen den Bus verstärkt als modernes, umweltfreundliches Verkehrsmittel wahr.
Vehicle-to-Grid-Technologie: Stromnetze stabilisieren mit E-Autos
Ein vielversprechender Ansatz zur Integration von Elektrofahrzeugen in das Energiesystem ist die Vehicle-to-Grid-Technologie (V2G). Hierbei werden die Batterien von E-Autos als flexible Speicher genutzt, um Schwankungen im Stromnetz auszugleichen. Dies ist besonders relevant für die Integration erneuerbarer Energien, deren Erzeugung oft starken Schwankungen unterliegt.
Das Prinzip von V2G ist einfach: Wenn zu viel Strom im Netz vorhanden ist, laden die E-Autos ihre Batterien. Bei
Schwankungen im Stromnetz auszugleichen. Bei Spitzenlasten oder Unterversorgung können die Fahrzeugbatterien Strom ins Netz zurückspeisen und so zur Netzstabilität beitragen.
Pilotprojekte in verschiedenen europäischen Städten zeigen das Potenzial dieser Technologie. In Amsterdam beispielsweise wurde ein V2G-System mit 50 Elektrofahrzeugen getestet. Die Ergebnisse waren vielversprechend: Die Fahrzeuge konnten erfolgreich zur Netzstabilisierung beitragen, ohne dass die Nutzer in ihrer Mobilität eingeschränkt wurden.
Für eine breite Umsetzung von V2G sind noch einige technische und regulatorische Herausforderungen zu meistern. Dazu gehören die Standardisierung von Schnittstellen, die Anpassung von Netzinfrastrukturen und die Entwicklung von Geschäftsmodellen, die sowohl für Fahrzeugbesitzer als auch für Netzbetreiber attraktiv sind.
Vehicle-to-Grid-Technologie kann E-Autos von blossen Stromverbrauchern zu aktiven Teilnehmern im Energiesystem machen und so die Integration erneuerbarer Energien unterstützen.
Smart City-Konzepte für effiziente Verkehrssteuerung
Smart City-Konzepte spielen eine zunehmend wichtige Rolle bei der Gestaltung nachhaltiger und effizienter urbaner Mobilitätssysteme. Durch den Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien können Verkehrsströme optimiert, Emissionen reduziert und die Lebensqualität in Städten verbessert werden.
Kernelemente eines Smart City-Ansatzes im Bereich Mobilität sind:
- Echtzeitdatenerfassung und -analyse
- Intelligente Verkehrssteuerungssysteme
- Vernetzte Infrastruktur (z.B. smarte Strassenbeleuchtung)
- Integrierte Mobilitätsplattformen
- Predictive Maintenance für Verkehrsinfrastruktur
Die Implementierung solcher Konzepte erfordert oft erhebliche Investitionen, kann aber langfristig zu deutlichen Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen führen. Zudem tragen Smart City-Lösungen dazu bei, den Verkehr flüssiger und sicherer zu gestalten und die Umweltbelastung zu reduzieren.
Echtzeitdatenerfassung: Verkehrsflussoptimierung durch intelligente Ampelschaltungen
Ein zentrales Element moderner Verkehrssteuerung ist die Echtzeiterfassung und -analyse von Verkehrsdaten. Durch den Einsatz von Sensoren, Kameras und vernetzten Fahrzeugen können Städte ein präzises Bild der aktuellen Verkehrssituation gewinnen und darauf basierend intelligente Steuerungsmassnahmen ergreifen.
Ein Paradebeispiel hierfür sind adaptive Ampelschaltungen. Diese passen sich in Echtzeit an das aktuelle Verkehrsaufkommen an und optimieren so den Verkehrsfluss. In Städten wie Singapur oder London, die solche Systeme bereits grossflächig einsetzen, konnten Wartezeiten an Kreuzungen um bis zu 25% reduziert und der Durchfluss um bis zu 40% gesteigert werden.
Darüber hinaus ermöglicht die Echtzeitdatenerfassung auch eine bessere Planung von Baustellen und Umleitungen sowie eine effizientere Steuerung des öffentlichen Nahverkehrs. Busse und Bahnen können so priorisiert und Verspätungen minimiert werden.
Predictive Maintenance: KI-gestützte Wartung von Verkehrsinfrastruktur
Predictive Maintenance, also die vorausschauende Wartung, gewinnt im Bereich der Verkehrsinfrastruktur zunehmend an Bedeutung. Durch den Einsatz von Sensoren und künstlicher Intelligenz können potenzielle Probleme frühzeitig erkannt und behoben werden, bevor es zu Ausfällen oder Sicherheitsrisiken kommt.
Ein innovatives Beispiel hierfür ist das Projekt „Smart Bridge“ in den Niederlanden. Hier wurde eine stark frequentierte Brücke mit einem Netzwerk aus Sensoren ausgestattet, die kontinuierlich Daten über den Zustand der Struktur liefern. Ein KI-System analysiert diese Daten und kann so Verschleiss oder Schäden frühzeitig erkennen. Dies ermöglicht eine effizientere Planung von Wartungsarbeiten und verlängert die Lebensdauer der Infrastruktur.
Ähnliche Ansätze werden auch für die Wartung von Strassen, Schienen und anderen Verkehrsinfrastrukturen entwickelt. Die Vorteile sind vielfältig:
- Reduzierung ungeplanter Ausfälle und Störungen
- Optimierung von Wartungsintervallen und -kosten
- Erhöhung der Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer
- Verlängerung der Lebensdauer von Infrastrukturelementen
Mobility-as-a-Service (MaaS): Die Whim-App in Helsinki als Vorreiter
Mobility-as-a-Service (MaaS) ist ein innovatives Konzept, das verschiedene Verkehrsangebote in einer einzigen Plattform integriert. Nutzer können so ihre gesamte Mobilität – vom öffentlichen Nahverkehr über Carsharing bis hin zu Leihfahrrädern – über eine einzige App planen, buchen und bezahlen.
Ein Vorreiter in diesem Bereich ist die Whim-App in Helsinki. Seit ihrer Einführung 2016 hat sie die Art und Weise, wie Menschen in der finnischen Hauptstadt mobil sind, grundlegend verändert. Nutzer können zwischen verschiedenen Abonnement-Modellen wählen, die unbegrenzte Nutzung des ÖPNV, Zugang zu Carsharing und Leihfahrrädern sowie Taxifahrten zu einem Festpreis beinhalten.
Die Ergebnisse sind beeindruckend:
- Über 60% der Whim-Nutzer geben an, seltener ein eigenes Auto zu nutzen
- Die Nutzung des ÖPNV ist um 25% gestiegen
- Der Anteil von Carsharing und Leihfahrrädern an den zurückgelegten Wegen hat sich verdoppelt
Der Erfolg von Whim hat zahlreiche Städte weltweit inspiriert, ähnliche MaaS-Konzepte zu entwickeln. Experten sehen in diesem Ansatz einen wichtigen Baustein für die Zukunft urbaner Mobilität, da er die Nutzung nachhaltiger Verkehrsmittel fördert und den Bedarf an privaten PKWs reduziert.
Nachhaltige Stadtplanung: Konzept der 15-Minuten-Stadt
Das Konzept der 15-Minuten-Stadt gewinnt in der nachhaltigen Stadtplanung zunehmend an Bedeutung. Die Grundidee: Alle wesentlichen Einrichtungen des täglichen Lebens – von Arbeitsplätzen über Einkaufsmöglichkeiten bis hin zu Freizeitangeboten – sollen innerhalb von 15 Minuten zu Fuss oder mit dem Fahrrad erreichbar sein.
Dieser Ansatz bietet mehrere Vorteile:
- Reduzierung des motorisierten Verkehrs und damit der Emissionen
- Förderung aktiver Mobilität (Gehen, Radfahren)
- Stärkung lokaler Gemeinschaften und Wirtschaftskreisläufe
- Verbesserung der Lebensqualität durch kürzere Wege und weniger Verkehrsbelastung
Paris hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2024 eine 15-Minuten-Stadt zu werden. Dazu werden Strassen für den Autoverkehr gesperrt, Grünflächen geschaffen und lokale Dienstleistungen gefördert. Auch andere Metropolen wie Melbourne und Portland experimentieren mit ähnlichen Konzepten.
Die Umsetzung erfordert oft tiefgreifende städtebauliche Veränderungen und kann auf Widerstand stossen, insbesondere von Autofahrern. Langfristig verspricht das Konzept jedoch, Städte lebenswerter, nachhaltiger und widerstandsfähiger zu machen.
Best Practices: Erfolgreiche Umsetzung sanfter Mobilität in europäischen Städten
Zahlreiche europäische Städte haben in den letzten Jahren beeindruckende Fortschritte bei der Umsetzung sanfter Mobilitätskonzepte gemacht. Ihre Erfahrungen bieten wertvolle Erkenntnisse für andere Kommunen, die ähnliche Ziele verfolgen.
Kopenhagen: Fahrradstadt par excellence mit Supercykelstier
Kopenhagen gilt weltweit als Vorbild für fahrradfreundliche Stadtplanung. Über 60% aller Wege zur Arbeit oder Ausbildung werden hier mit dem Fahrrad zurückgelegt. Ein Schlüssel zu diesem Erfolg sind die sogenannten Supercykelstier (Fahrrad-Schnellwege).
Diese speziellen Radwege verbinden die Vororte mit dem Stadtzentrum und zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:
- Breite, gut ausgebaute Fahrbahnen
- Minimale Kreuzungen mit dem Autoverkehr
- Grüne Welle für Radfahrer bei 20 km/h
- Servicestationen mit Luftpumpen und Reparaturmöglichkeiten
Das Netz der Supercykelstier wird kontinuierlich ausgebaut und soll bis 2045 eine Gesamtlänge von 750 km erreichen. Studien zeigen, dass diese Investitionen sich auszahlen: Für jeden in die Fahrradinfrastruktur investierten Euro spart die Stadt 5,70 Euro an Gesundheits- und Infrastrukturkosten.
Wien: Effiziente Kombination von U-Bahn, Strassenbahn und Stadtrad
Wien hat in den letzten Jahren ein beeindruckendes multimodales Verkehrssystem aufgebaut, das U-Bahn, Strassenbahn, Bus und Fahrrad nahtlos miteinander verknüpft. Ein Schlüsselelement ist die günstige Jahreskarte für den öffentlichen Nahverkehr, die für nur 365 Euro erhältlich ist.
Ergänzt wird das ÖPNV-Angebot durch das Stadtrad-System, das über 1.500 Leihfahrräder an 120 Stationen bietet. Die ersten 60 Minuten jeder Fahrt sind kostenlos, was die Nutzung für kurze Strecken besonders attraktiv macht.
Die Erfolge dieser Strategie sind beachtlich:
- Der Modal Split zugunsten des Umweltverbunds (ÖPNV, Rad, Fussgänger) liegt bei über 70%
- Die Zahl der ÖPNV-Jahreskartenbesitzer hat sich seit 2012 verdoppelt
- Der Anteil des Radverkehrs ist von 6% (2010) auf 9% (2020) gestiegen
Wien zeigt eindrucksvoll, wie eine konsequente Förderung nachhaltiger Mobilitätsformen den Modal Split einer Grossstadt positiv beeinflussen kann.
Freiburg im Breisgau: Vauban als autofreies Vorzeigequartier
Das Freiburger Stadtviertel Vauban gilt international als Musterbeispiel für nachhaltigen Städtebau und autofreies Wohnen. Das ehemalige Kasernengelände wurde in den 1990er Jahren zu einem Wohngebiet für 5.500 Menschen umgestaltet, wobei von Anfang an auf eine autoarme Planung gesetzt wurde.
Zentrale Elemente des Mobilitätskonzepts in Vauban sind:
- Stellplatzfreie Wohnstrassen
- Zentrale Sammelgaragen am Quartiersrand
- Exzellente ÖPNV-Anbindung durch Strassenbahn
- Engmaschiges Netz von Fuss- und Radwegen
- Carsharing-Angebote für Bewohner
Das Ergebnis ist beeindruckend: Nur 16% der Haushalte in Vauban besitzen ein eigenes Auto, verglichen mit 43% im Freiburger Durchschnitt. Der Anteil des Radverkehrs liegt bei über 60%. Gleichzeitig zeichnet sich das Viertel durch eine hohe Lebensqualität und starken sozialen Zusammenhalt aus.
Vauban demonstriert, dass autofreies oder autoarmes Wohnen auch in modernen Städten möglich und attraktiv ist. Das Konzept hat zahlreiche Nachahmer in anderen europäischen Städten gefunden und gilt als Blaupause für zukünftige nachhaltige Stadtentwicklungsprojekte.
Die Beispiele aus Kopenhagen, Wien und Freiburg zeigen: Sanfte Mobilität ist kein Zukunftstraum, sondern kann mit den richtigen Konzepten und politischem Willen schon heute Realität werden.